Erfolgreicher verkaufen, verhandeln und überzeugen!
Seit mehr als 20 Jahren statten wir weltweit Verkäufer, Führungskräfte und Sales-Teams mit hochwirksamen Verkaufs-, Überzeugungs- und Verhandlungswerkzeugen aus.
Wir haben für jedes Ziel das richtige Mittel, klick dich durch unseren kurzen Guide, und hebe deinen Verkauf auf Champions-League-Niveau!

Hall of Sales
Mehr als 150.000 Absolventen – darunter Verkäufer, Privatleute, Führungskräfte und Mitarbeiter verschiedenster renommierter Unternehmen, Behörden und Institutionen – haben unsere kybernetischen Verkaufs-, Verhandlungs- und Überzeugungstechniken erfolgreich erlernt und wenden diese hocheffektiv an.

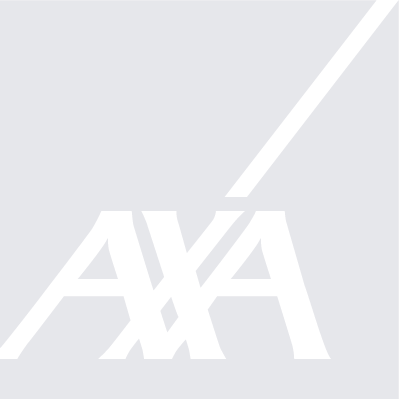


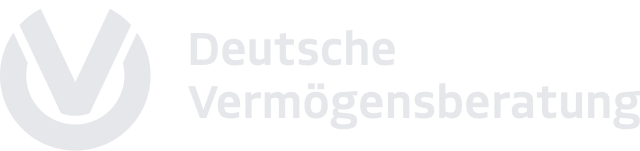




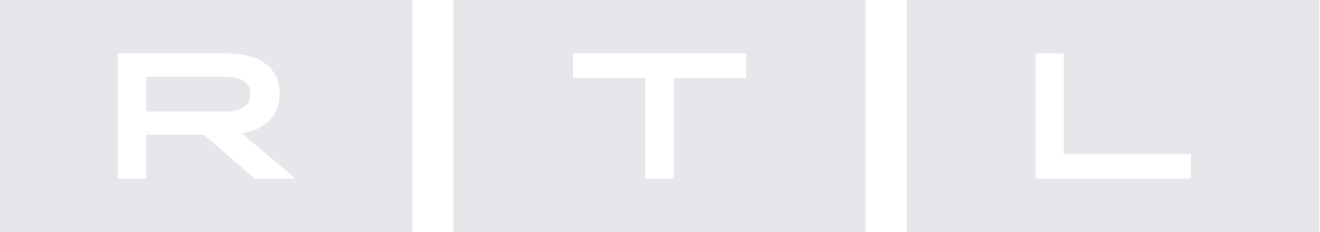
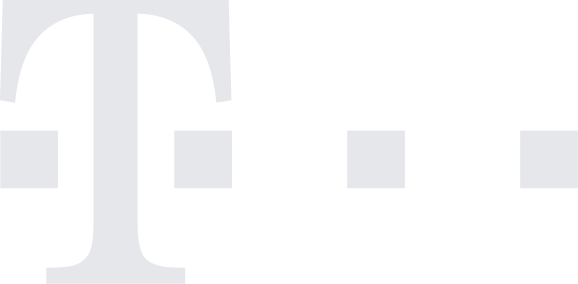
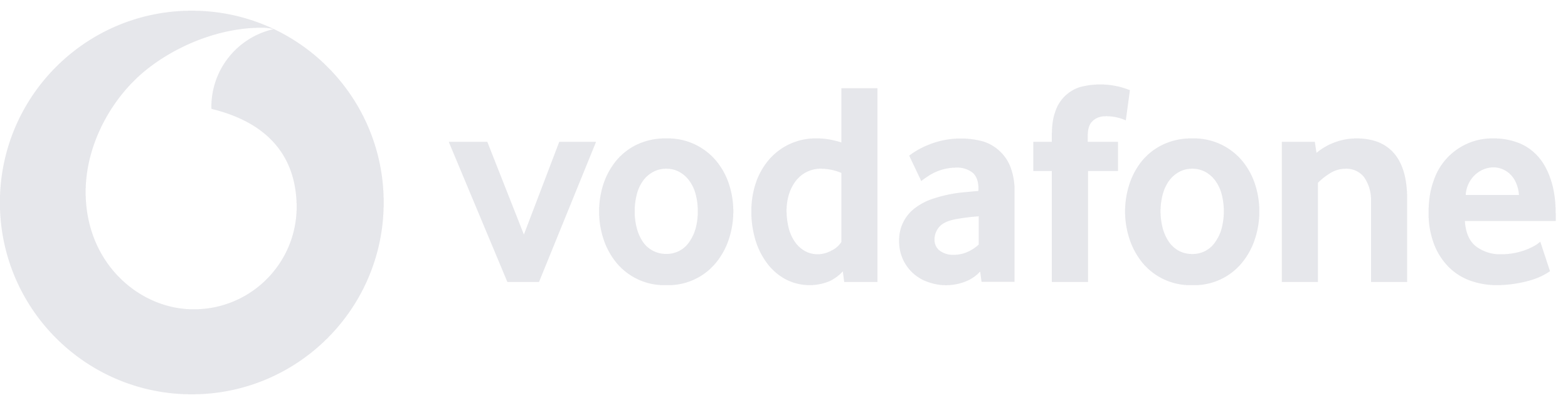
.. und viele weitere!

Die Online Academy
Die Beyreuther Academy – Deine ultimative Plattform für die Entwicklung von erstklassigen Verkaufsfähigkeiten! Wir bieten dir ein umfassendes Training, das auf modernsten Methoden basiert und von Experten entwickelt wurde.
In unserer App kannst du auf eine Vielzahl von interaktiven Lektionen zugreifen, die speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Egal, ob du Anfänger bist oder bereits Erfahrung im Verkauf hast – wir haben die passenden Lernmodule für jeden.
Unsere hochwertigen Videoinhalte ermöglichen es dir, von Experten zu lernen. Verfolge praxisnahe Szenarios, erhalte wertvolle Einblicke und perfektioniere deine Fähigkeiten durch visuelles Lernen.
Für ein hands-on-Erlebnis bieten wir außerdem interaktive Lernkoffer an, die Materialien und Ressourcen enthalten, um das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Diese Koffer sind das ideale Begleitwerkzeug, um das Training zu vertiefen und sicherzustellen, dass du das Maximum aus jedem Modul herausholst.
Unsere Academy ermöglicht es dir, flexibel zu lernen – sei es von zu Hause aus, unterwegs oder in deiner freien Zeit. Die Zukunft des Verkaufstrainings ist jetzt greifbar, und wir laden dich ein, Teil dieser innovativen Reise zu werden. Bereite dich darauf vor, deine Verkaufskompetenzen auf ein neues Niveau zu heben und deinen beruflichen Erfolg zu maximieren. Deine Reise beginnt hier – starte noch heute!
Die Exchange Plattform
Hier treffen leistungsorientierte Sales-Talente auf Unternehmen, die expandieren wollen.
Recruiter können mühelos durch eine Vielzahl von Talentprofilen stöbern und filtern, um genau die Vertriebsexperten zu finden, die ihren Anforderungen entsprechen. Mit maximaler Flexibilität können sie ihre Suchkriterien anpassen und so das perfekte Match für ihre Teams finden.
Die Exchange bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Talenten ermöglicht, ihre Verfügbarkeiten, Fähigkeiten und Gehaltsvorstellungen selbst zu verwalten. Gleichzeitig haben Recruiter die Freiheit, die Suche nach Talenten nach ihren eigenen Kriterien zu steuern.
Diese innovative Online-Plattform definiert die Regeln für personalisiertes Vertriebs-Matchmaking neu. Melde dich noch heute an und erlebe, wie die Zukunft der Vertriebsvermittlung aussieht, wo Talente und Recruiter gemeinsam erfolgreich werden!

Präsenztraining
Entfalte dein volles Potenzial durch maßgeschneidertes Coaching! Unser Expertenteam begleitet dich auf deiner Erfolgsreise und bietet Unterstützung in verschiedenen Schlüsselbereichen. Die Präsenztrainings ermöglichen dir, deine Verkaufsfähigkeiten zu perfektionieren, um in der Champions League des Verkaufs zu spielen.
Erlebe ein unvergleichliches Training unter der strahlenden Sonne der Balearen. Unser exklusives Event entführt Dich an eine atemberaubende Location auf der malerischen Insel Mallorca. Umgeben von der bezaubernden Schönheit des Mittelmeers, wird dieser Ort zur perfekten Kulisse für Deine Woche voller intensiver Lern- und Wachstumsmöglichkeiten.
Lass Dich von der inspirierenden Atmosphäre, dem kristallklaren Wasser und den idyllischen Landschaften Mallorcas verzaubern, während Du Deine Verkaufsfähigkeiten unter der Anleitung von Carsten Beyreuther – einem Meister seines Fachs – in völlig neue Verkaufssphären schießt.



